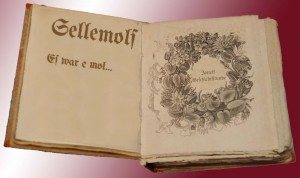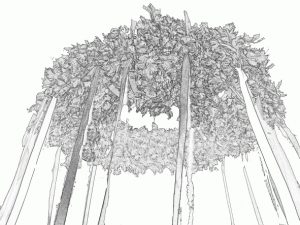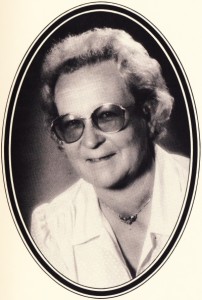Wem is die Kerb? – Unser!
Von Frank Oppermann
Wohl kaum ein anderer Schlachtruf wie die immer wieder lautstark und selbstbewußt in die Menschenmenge des Volksfestes gerufene scheinbare Frage der Kerbburschen „wem ist die Kerb?” und die darauf auch gleich von denselben Burschen noch lautstarker gegebene Antwort „unser!”, zeigt Bedeutung und Wandel von öffentlichen Festen besser auf als dieser Spruch. Der jeweilige Jahrgang der zum Militär einrückenden jungen Männer bestimmte das Kerbgeschehen, „ihnen war die Kerb”, sie tanzten am meisten, sie tranken am meisten und sie organisierten sich, um die Musikkapelle zu bezahlen, um das örtliche Geschehen des vergangenen Jahres zu persiflieren und um die Kerb mit vielerlei Aktionen auszugestalten. Und wehe, wenn eine andere Jahrgangsgruppe oder gar Burschen aus benachbarten Orten die Beantwortung dieser Frage übernahmen, so war dies oft genug Signal für eine Massenrauferei.
Wichtigste Voraussetzung dieser Kerbbräuche war eine sich stützende und sich auch andererseits kontrollierende soziale Dorfgemeinschaft, mit von allen akzeptierten oder zumindest mitgetragenen Verhaltensregeln. Obwohl der religiöse Bezug der Kirchweihfeste – falls überhaupt je vorhanden – sich relativ früh, wohl schon im Mittelalter, löste, blieb die Sozialverbindlichkeit der Kerb als das einzige öffentliche Fest einer Gemeinschaft lange erhalten. („Die Kerb ist unser!”) Sie war das verbindliche Ergebnis einer Ortsgemeinschaft, zu dem auswärtige Verwandte eingeladen wurden, nicht mehr am Ort wohnende Bürger zu Besuch kamen; sie war der öffentliche Treffpunkt der Jugend dieser Gemeinschaft schlechthin, der Heiratsmarkt, Nachrichtenbörse und gemeinschaftliches aktives Feiern gleichermaßen darstellte.
Doch dies hat sich heute geändert. Mit einem Wandel unseres gesellschaftlichen Wertesystems ist die Kerb nicht mehr das was sie war und zu einem unter vielen Volksfesten degradiert. Die Rolle der heutigen dörflichen oder kleinstädtischen Öffentlichkeit beschränkt sich auf passives Zusehen oder
Konsumieren. Nur noch ein verschwindend geringer Prozentsatz der Bevölkerung eines Ortes nimmt überhaupt am Kerbgeschehen teil. Das Verlagern gesellschaftlicher Verhaltensweisen in andere Gebiete (Fernsehen, Urlaub, Diskothek), ein Überangebot an Unterhaltungsmöglichkeiten gerade bei den großen Volksfesten in unserer Region (Wäldchestag Frankfurt, Heinerfest Darmstadt, Ebbelwoifest Langen), die fast nicht mehr zu überblickenden, jährlich wiederkehrenden Kultur- und Stadtteilfeste („Altstadtfest” in Neu-Isenburg, „Hooschebaa”-Fest in Sprendlingen, „Weiberkerb”, „Töpfermarkt” und „Burgfest” in Dreieichenhain, „Bachgassenmarkt” in Langen, Historische Märkte und Weinfeste andernorts) und unzählige Straßenfeste, Vereinsabende und Nachbarschaftsgrillparties haben die Kerb ihrer ursprünglichen Funktion beraubt. Ihre alten Bräuche und Riten muten der modernen Gesellschaft wie ein Märchen von „anno-schon-e‘-mals” an. Die Kerb ist nicht mehr „unser”- sie ist lediglich ihren wenigen Organisatoren.
Dies wird oft genug als Mißstand empfunden. Die Kerb wird zwar in allen Orten des Dreieichgebietes mit „Schausteller- und Vergnügungsparks” begangen, aber eine sich aus einer alten örtlichen Sozialstruktur wie selbstverständlich jährlich neu rekrutierenden Kerbburschengruppe gibt es nur noch in Dreieichenhain und Egelsbach. ln Langen und Götzenhain haben sich Kerbvereine gebildet, um die jährliche Kerb mit traditionellen Bräuchen auszugestalten. Wohl unbewußt arbeiten sie hier an einem kleinen Aspekt eines übergreifenden gesamtkulturellen Problems. Der Entfremdung und der Austauschbarkeit des Einzelnen und der Kleingruppe innerhalb der Industriegesellschaft und die äußerst geringen Möglichkeiten an aktiver Mitgestaltung des kulturellen und gesellschaftlichen Umfeldes stehen die praktizierten historischen Bräuche der örtlichen Kirchweihfesten gegenüber, die wiederum letztlich auch Versuche sind, eine mitbeeinflußbare lokale Identität herzustellen. …
Quelle: Landschaft Dreieich 1989